Die Top-Erfolge der deutschen Geschichte
Die kalkulierte "Vogelschiss"-Provokation war widerwärtig. Was dabei ein bisschen unterging: Auch der Rest, das mit den "1000 erfolgreichen Jahren deutscher Geschichte", ist gefährlicher Unsinn.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/deutschland-die-erfolge-der-deutschen-geschichte-sind-unsinn-kolumne-a-1211775.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/deutschland-die-erfolge-der-deutschen-geschichte-sind-unsinn-kolumne-a-1211775.html
skip to main |
skip to sidebar
.jpg)
Fundstücke, Seltsames, Absurdes und manchmal etwas Musik
.jpg)
Blog Archive
-
▼
2018
(3871)
-
▼
Juni
(260)
- Mein Zuhause für die nächsten Tage
- A.I. recreates periodic table of elements from scr...
- Es gibt nicht nur schlechte News aus Amiland.
- »NÜRNBERG - 19 Jahre nach dem Rohrbombenattentat a...
- Via Daniel Glass
- Title
- Ja, ja, früher war alles besser. ^^
- Next time you‘re travelling, consider Trump Hotels!
- Links die Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentu...
- Für reflektierte Menschen nix neues, aber durchaus...
- Schlossbau einfach gemacht.
- #fcknzs
- Frauenhäuser. Ein weiteres Beispiel aus dem Mangel...
- Könnte von Lindner sein.
- Unsere "Verbündeten":
- Obergrenze aus wissenschaftlicher Sicht.
- Moin :)
- Wozu noch mit Rechten reden, wenn alle bereits wie...
- Black
- via Serafina Kopp
- Festiva-Cation fehlt, eindeutig.
- Der Plattenladen ist ein Scherbenhaufen. Zerfällt ...
- Via Asoziales Netzwerk - Sektion Mittelrhein
- Title
- Ob ich mich morgen noch daran erinnern kann? ^^
- Bad Religion - "The Kids Are Alt-Right"
- Time
- Fete de la Musique
- Da ist was dran. ^^
- Passt ins Bild.
- Die Schamlosigkeit bei Fox News ist unfassbar.
- via Thomas Rohde
- Ein neues Thema für Flacherdler. ^^
- Lesenswert
- Title
- Ambientes Zeug, gemixt von Roel Funcken (u. a. Fun...
- #currentmood
- via Marcus Kranawetter
- Anordnung des (Europa-)Rechtsbruchs
- Bitter nötig.
- Eine Hoffnung kann man beim Stern ja haben: Aufgru...
- Lilo Herrmann
- Via André Baum
- https://twitter.com/MIA_macht_das/status/100906853...
- https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/in...
- https://www.nbcnews.com/health/health-news/kids-su...
- How the Koch Brothers Are Killing Public Transit P...
- Kicher
- Es gibt einfach eine Steigerung zu Busch. Na ja.
- Title
- Kommt mir auch so vor.
- Kleiner musikalischer Tipp
- Nazi-Demo in Salzgitter
- Ausgerechnet der Tag? Gab es nix anderes? Den 08.0...
- Neues von #FeineSahneFischfilet
- Defenders of Democracy
- Via Serafina Kopp
- Lesenswert
- via Dan Thompson
- Es heißt doch doch immer "Alles wird gut", oder? ^^
- via Serafina Kopp
- Wie lange soll es noch dauern, bis endlich die Ver...
- Das kann passieren, wenn mensch mit Muffins gelock...
- Wie du noch bis 20. Juni Zensurmaschinen und das E...
- Pfeffersprayer gegen Sprayer
- Turn around - Turn around
- Mit der notwendigen Klarheit und Härte.
- Nachtrag zum Beutegermanen-Kellernazi, der bereits...
- Teures Pflaster.
- Eine wichtige Nachricht für #Pebble Nutzer: Meldet...
- Father's Day Under Trump: A Grotesque Exercise in ...
- "Hair Day"
- Daher sind die Tierchen vom Aussterben bedroht.
- GN8
- Wohnraum ist ein Ort für Familie, für Nähe und Geb...
- Spendiere eine Fahrradkette.
- Die Gunst der rechten Stunde
- Title
- #Sonntagskonzert
- Matthew Herbert aka Radio Boy - Live (MusicPlanet ...
- Ein Aufseher des US-Justizministeriums wirft #Koch...
- Ein Netzwerk Gleichgesinnter
- Sam Szafran - Escalier 54 Rue de Seine, 1990
- via Niele Popiele
- ‘You’re Deleting Your Account? We’ll Be Sad To See...
- Nachtrag Herr Seehofer.
- Hmmm, nein.
- via Marco Modano
- Eine machtbesessene Regionalpartei hat sich seit J...
- Oha, die Tagesschau bemerkt RSS...
- via laяƧ
- don't judge a book by its cover
- Immer schön aufpassen mit dem Essen.
- Title
- Schaum vor dem Mund, Angst im Blick, Hass im Herze...
- via Serafina Kopp
- via Ralf Koch
- Lügen, heulen, hetzen, Blaubraune halt
- Es gibt viel zu tanzen, puh. ^^
- Und da soll nochmal einer sagen Satire könne nicht...
-
▼
Juni
(260)
Top
Copyright 2009 Picknick am Wegesrand All rights reserved. Powered by Blogger
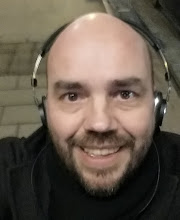
7 Kommentare:
Vermutlich kann man in vorhergehenden ca. 1000 Jahren der Geschichte in Mitteleuropa auch Positives/Erfolge sehen. Aber das waren aus heutiger Sicht wohl oft eher die Geschehnisse, die nicht so sehr durch im Sinne eines deutschen Nationalismus oder auch nur einer deutschen Nation „erfolgreich“ waren.
Ich hatte neulich eine Menge Erfolge aufgezählt, leider kaum positive.
Die Erfolge Einzelner, sei es Gutenberg oder andere, möchte ich nicht dazu zählen.
„Erfolge“ oder „erfolgreich“ passt wohl schon von der Wortwahl eher zu einem (hoffentlich außerhalb der AfD-Anhänger nicht mehr üblichen) Geschichtsverständnis, das von einem Wettkampf von Herrschern oder Nationen/Staaten ausgeht. Und das Heilige Römische Reich war wohl auch eher etwas wie ein überstaatliches Gebilde oder etwas, was zwischen Bundesstaat und Staatenbund stand oder schwankte.
Als etwas Positives oder Auch-Positives fällt mir spontan ein:
- Goldene Bulle (in Richtung Föderalismus)
- Relative Unabhängigkeit der Städte
- Westfälischer Friede
- Verwaltungsgerichtsbarkeit
- Sozialversicherungssystem (dadurch Auswirkungen der industriellen Revolution im Vergleich zu England sozial etwas gemäßigter)
- Koalitionsfreiheit (mit Vorläufern wohl schon bei Gesellenschaften einerseits und Zünften andererseits)
- Grundgesetz mit zentraler Rolle der Würde des Menschen
- Bundesverfassungsgericht
Den westfälischen Frieden würde ich rausnehmen, den Beteiligten blieb nicht mehr viel übrig, als sich zu vertragen. Der halbe Kontinent war verwüstet.
Mit der goldenen Bulle wurde die Person des Kaisers und seine Wahl reglementiert, das Erbe von Begüterten vulgo Adligen geregelt. Für Arme blieb nur übrig, an wen sie sich wenden konnten, ihren Landesherren.
Relative Unabhängigkeit der Städte Meinst Du freie Städte und Reichsstädte? Das war Glücksache und der normalen Bevölkerung ging es nicht besser, sie waren nur keine Leibeigene mehr.
Das Sozialversicherungssystem als Folge der Bekämpfung der Sozialdemokratie durch Bismarck. „Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewinnen, oder soll ich sagen zu bestechen, den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte“
Beim Grundgesetz, der Koalitionsfreiheit, dem BVG und der Verwaltungsgerichtsbarkeit bin ich bei Dir.
Aber es ist deutlich zu merken, dass ein Jurist diese Liste geschrieben hat. ^^
Die damaligen Beweggründe der handelnden Personen würde ich nicht berücksichtigen, auch deshalb würde ich deshalb wenn dann eher abstellen auf: positiv/mit positiven Folgen als auf „erfolgreich“.
Die Charter of Liberties und die verschiedenen Versionen der Magna Carta dürften auch nicht als besonderer Freiheitsliebe von Heinrich I, Johann Ohneland oder Heinrich III unterzeichnet worden sein und dem normalen Menschen haben sie vermutlich erst in ihrer Nachwirkung etwas gebracht.
Und den (wohl u. a. auf die Goldene Bulle zurückgehenden) Föderalismus empfinde ich schon als positive Entwicklung:
Und sei es dass ich (vorerst) meist vor vielen „Erfolgen“ der CSU in der Novelle zum bayrischen Polizeirecht verschont bleibe.
Aber man sollte wohl sowieso in der Geschichte eher verschiedene/entsprechende Möglichkeiten in verschiedenen/entsprechenden Zeiten mit möglichen Vor- und Nachteilen vergleichen und auf Entwicklungsstränge schauen, anstatt zu versuchen, eine absolute Wertung aufzustellen oder gar frühere Zeiten immer an unseren jetzigen Maßstäben zu messen.
Der heutige Föderalismus ist eher auf die Einwirkung der Alliierten zurückzuführen.
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6deralismus_in_Deutschland#Bundesrepublik_Deutschland_(seit_1949)
Einer Analyse nur im historischen Kontext ohne Bewertung der Handlung und deren Folgen aus heutiger Sicht würde etwas fehlen.
Absolute Wertungen stehen mir nicht zu.
Das ganze Inhalt des ursprünglichen Grundgesetz dürfte sehr maßgeblich auf den Einfluss der Aliierten zurückzuführen sein, +Thomas Mertens . Und die konkrete Einteilung der (Bundes-)länder hatte vermutlich auch viel mit der Angst der Alliierten vor einem starken/übermächtigen Preußen zu tun.
Und die die Staatsgewalt begrenzende Funktion des Föderalismus (vertikale Gewaltenteilung) konnte wohl auch erst nach der Zerschlagung Preußens sinnvoll wirksam werden, auch wenn die Entmachtung der gemäßigten Regierung Preußens (sog. Preußenschlag) für die folgende Machtergreifung der NSDAP nicht unerheblich gewesen sein dürfte.
Aber die konkrete Gestaltung des Föderalismus im Grundgesetz scheint doch eher von den deutschen Nachkriegs-Politikern und Verfassungs-'Eltern' ausgegangen zu sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland#Zwischen_Kriegsende_und_der_Londoner_Sechs-M%C3%A4chte-Konferenz
Und die föderalistische Ordnung des Grundgesetzes ging eben auch auf eine föderalistische Geschichte und regional verwurzelte Landes-Verbundenheit zurück - besonders in Süddeutschland.
Dass der Föderalismus in Grundgesetz eher funktionieren konnte als in der Weimarer Rechtsverfassung ging aber wohl tatsächlich auf die schon vorher umgesetzte Entscheidung der Alliierten zurück, Preußen auflösen zu lassen:
»Da eine Zerschlagung Preußens nach dem Ersten Weltkrieg nicht gelang und politisch wohl auch ausgeschlossen war, wurde lediglich an den Symptomen des „asymmetrischen Föderalismus” herumgedoktert: Zu nennen sind besonders die im Prinzip schon aus dem Kaiserreich bekannten clausulae antiborussicae (Art. 61 I 4, Art. 63 I 2 WRV) zur Beschränkung der preußischen Stimmen. In der politischen Diskussion verfiel man immer wieder in die an die Struktur des Kaiserreichs angelehnte Überlegung, Preußen und das Reich engzuführen, ja Preußen im Reich aufgehen zu lassen. – Das Grundgesetz war der preußischen Frage durch die von den Alliierten verfügte Auflösung Preußens 1947 enthoben.«
Kai von Lewinski: Weimarer Reichsverfassung und Grundgesetz als Gesellen- und Meisterstück, JuS 2009, 505-511 (506), beck-online
Kommentar veröffentlichen